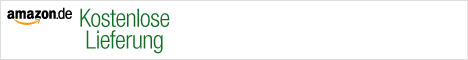Wissenschaftliches Investieren heißt, man verlässt sich bei der Geldanlage auf wissenschaftliche Erkenntnisse über den Kapitalmarkt, statt auf individuelle Meinungen von Beratern oder in den Medien gehypte Trends. Die Basis für das wissenschaftliche Investieren sind die moderne Portfolio-Theorie, die Markteffizienztheorie sowie die Risiko-Preis-Modelle von Sharpe, Lintner, Mossin bzw. von Fama und French.

Wissenschaftliches Investieren bei der Geldanlage
Ihre Ansätze beschreiben erstens, wie sich durch breit gestreute Portfolios Anlagerisiken minimieren und Renditeerwartungen maximieren lassen. Sie zeigen zweitens, warum der Versuch, die Kapitalmarktrendite zu schlagen, sich weder lohnt noch empfiehlt. Und ihre Ansätze bieten drittens Maßstäbe, mit denen sich Risiken und Renditeerwartungen messen bzw. vergleichen lassen.
Obwohl all diese Theorien und Modelle seit 30 und mehr Jahren bekannt und anerkannt sind, bestimmen sie bis heute nicht das Handeln von Fondsmanagern und Finanzberatern. Denn diese vermeintlichen Experten glauben, es besser zu können als die Wissenschaft – und dass man ihnen dies auch glaubt, daran hängt ihre Existenz. Das die wissenschaftlichen Erkenntnisse ignorierende Handeln führt zur Vernichtung von Vermögen und erschwert den Vermögensaufbau vor allem den „Normalverdienern“, die Reserven und Renten für das Alter aufbauen müssen.
Wissen verdrängt Gurus
Quer durch die wirtschaftliche Welt lässt sich zurzeit ein universeller Trend beobachten: Wo bislang Erfahrung und „Geheimwissen“ von Experten, Gurus und Veteranen Vorgehen und Prozesse bestimmten, setzen sich zunehmend wissenschaftliche Verfahren, datengetriebene Algorithmen und Modelle durch, weil sie die Effektivität und Effizienz um Größenordnungen steigern. Das gilt für unterschiedliche Bereiche wie Marketing, Produktionsplanung oder Logistik gleichermaßen.
Auf dem Kapitalmarkt ist das Bild diffus. Einerseits tummeln sich hier die intelligentesten Vertreter der Absolventengenerationen der letzten 20 Jahre. Diese tüftelten als „Quants“ an den wildesten Finanzprodukten und Algorithmen, die in Bruchteilen von Sekunden Milliarden automatisiert um die Welt pumpen, und haben dabei fast das gesamte Finanzsystem in die Luft gejagt.
Andererseits versuchen Fondsgesellschaften und Anlagegurus mit quasi vorwissenschaftlichen Methoden durch das Kaufen und Verkaufen von Aktien eine Rendite zu erzielen, die über der des Marktes als Ganzes liegt. (Der Laie kann eine einfache Version der Marktrendite am täglich vermeldeten Stand des DAX-Index erkennen.) In der Regel schaffen sie dies jedoch nicht.
Dabei wurden in den 50er-, den 60er- und den 90er-Jahren die wissenschaftlichen Grundlagen entwickelt, mit denen Vermögen ruhig, ohne Spekulation und kontinuierlich aufgebaut werden kann.
Vier zentrale Theorien der Kapitalmarktforschung bilden die Basis des wissenschaftlichen Investierens:
- die moderne Portfoliotheorie
- die Markteffizienztheorie
- das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und das Drei-Faktoren-Modell für die Aktienrenditen
Moderne Portfoliotheorie, Harry Markowitz, 1953 – Risiken wegstreuen
Die moderne Portfoliotheorie ist die kapitalmarktwissenschaftliche Version der Lebensweisheit „Lege nicht alle Eier in einen Korb“. Harry Markowitz hatte mit seiner Kapitalmarktforschung Folgendes erkannt: Zum einen gibt es sinnvolle (systematische) Anlagerisiken, die mit einer höheren Renditeerwartung verbunden sind – wenn man z. B. in ein neugegründetes Unternehmen investiert –; und es gibt nicht-sinnvolle (unsystematische) Risiken, die nicht belohnt werden.
Markowitz zeigte, dass man die unsystematischen Risiken durch die Verteilung (Streuung oder Diversifizierung) seiner Geldanlage ausmerzen kann. Vereinfacht gesagt: Man reduziert die Risiken, die von einzelnen Aktien ausgehen, dadurch, dass man mit vielen Aktien ein „effizientes“ Portfolio zusammenstellt. Effizient ist ein Portfolio dann, wenn die Gesamtheit der darin enthaltenen Anlageobjekte keine unsystematischen Risiken mehr aufweist.
Dies erreicht man dadurch, dass im Portfolio Wertpapiere zusammengestellt werden, die sich nicht gegenseitig beeinflussen. So ist es beispielsweise unklug, gleichzeitig in Handels- und in Transportunternehmen zu investieren. Denn wenn es dem Handel schlecht geht, dann leidet auch die Transportbranche, weil sie weniger Waren zu transportieren hat. Dieser Fall wäre ein typisches, unsystematisches Portfoliorisiko (also „zu viele Eier in einem Korb“). In Handels- und in Pharmaunternehmen zu investieren macht wiederum Sinn, weil deren Branchen sich relativ unabhängig voneinander entwickeln. Denn wenn Konsumenten weniger einkaufen, so bedeutet das nicht, dass sie auch weniger Medikamente benötigen.
Die Lehre der modernen Portfoliotheorie für das wissenschaftliche Investieren besagt also: Investiere breit gestreut in verschiedene Branchen, in verschiedene Länder und in verschiedene Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Immobilien etc.).
Die Markteffizienztheorie von Eugene Fama, 1961 – Der Markt ist nicht zu schlagen
Die Markteffizienztheorie besagt komprimiert: Niemand kann auf Dauer den (Kapital-) Markt schlagen. Wissenschaftlicher ausgedrückt: Der Preis eines Wertpapiers (z. B. der Aktienkurs) spiegelt alle verfügbaren Informationen über dieses Wertpapier wider, also auch über die Erwartungen hinsichtlich seiner künftigen Entwicklung.
Der aktuelle Kurs einer Aktie reflektiert demnach den „öffentlich bekannten“ Wert eines Unternehmens. Änderungen des Aktienpreises sind immer Reaktionen auf unvorhergesehene Ereignisse. Das wiederum bedeutet, die Entwicklung von einzelnen Aktien (oder allgemeiner Wertpapiere) ist nicht vorhersehbar und somit zufällig.
Das heißt jedoch nicht, dass ein Aktienpreis immer die wahre Situation eines Unternehmens repräsentiert: Es kann durchaus zu preislichen Fehlentwicklungen kommen, weil relevante Unternehmensinterna nicht bekannt sind. Die ist aber für Außenstehende nicht zu erkennen – und wenn sie bekannt werden, werden diese Informationen sofort in den Kurs eingepreist.
Wenn wir die Markteffizienztheorie ernst nehmen, sind die Schlussfolgerungen für den derzeitigen Kapitalmarkt massiv: Ihr zufolge sind alle Fondsmanager, die teuer dafür bezahlt werden, dass sie Entwicklungen von Wertpapierkursen voraussehen, um durch günstigen Kauf und Verkauf die Anlagerenditen zu maximieren, im Grunde nutzlos.
Und tatsächlich zeigen Studien immer wieder: Auf die Dauer schafft es kein Fondsmanager kontinuierlich eine höhere Rendite zu erwirtschaften, als sie der Markt bietet. Dies gilt umso mehr, wenn man zudem die hohen Kosten mit berücksichtigt, die ein aktives Management von Geldanlagen verursacht.
Dass aktive Anlagemanager trotzdem höhere Gewinne oder niedrigere Verluste realisieren als der Markt, manchmal auch über Jahre hinweg, ist ein rein statistisches Phänomen: Da diese Anlagemanager den Finanzmarkt sehr zahlreich bevölkern, unterliegen die erzielten Renditen der sogenannten Normalverteilung: Einige liegen unter den Ergebnissen des Marktes, viele schneiden dem Markt vergleichbar ab, und einige wenige schaffen mehr Rendite.
Dabei ist es mehr oder weniger Zufall, welcher Anlagemanager gerade erfolgreich ist. Und wenn die Beobachtungszeit lang genug ist, pendeln sich alle Ergebnisse auf dem Marktniveau, allerdings vor Kosten für das aktive Management, ein. Diese Tendenz zur Marktrendite spiegelt sich auch in den immer wieder gern durchgeführten „Tiere-investieren-Experimenten“ wider: Lässt man Affen oder Katzen – sie werden gerne für solche Experimente ausgewählt – Geld anlegen, erzielen sie mit ihrer Zufallsverteilung der Investments die gleichen Renditeergebnisse wie aktive Manager.
Die Lehre der Markteffizienztheorie lautet: Als Anleger sollte man selbst nicht in einzelne Aktien investieren. Genauso wenig sollte man aktiven Fondsmanagern oder Vermögens-verwaltern vertrauen, die versprechen, mehr Rendite als der Markt liefern zu können. Stattdessen sollte man die Anlageangebote unter die Lupe nehmen, die versprechen, möglichst vollständige Marktrenditen zu erzielen – und die dabei zudem preiswert sind. Denn die Kosten sind die größten Renditefresser.
Risiko-Preis-Modelle: Das Capital Asset Pricing Model von William Sharpe, John Lintner und Jan Mossin sowie das Drei-Faktoren-Modell von Eugene Fama und Kenneth French
Moderne Portfolio- und Markteffizienztheorie besagen, dass Renditen nur aus sinnvollen Risiken entstehen, die ein Anleger eingeht, und nicht aus den Informationsvorsprüngen oder den seherischen Fähigkeiten von Fondsmanagern. Gleichzeitig konstatieren diese Theorien, dass unsystematische Risiken „weggestreut“ werden können. Bleibt die Frage: Welches systematische Risiko wird erwartungsgemäß mit welcher Rendite belohnt? Die Frage beantworten zwei Theorien: das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und das sogenannte Drei-Faktoren-Modell. Den ersten Nobelpreis-gewürdigten Ansatz für ein wissenschaftlich fundiertes Rendite-Risiko-Verhältnis lieferten William Sharpe, John Lintner und Jan Mossin in unabhängigen Forschungen in den 60er-Jahren. Ihre Forschungsergebnisse kondensierten sich im Capital Asset Pricing Model.
Die Wissenschaftler hatten gemessen, wie stark der Wert einer einzelnen Aktie (oder eines ganzen Portfolios) gegenüber dem Marktdurchschnitt schwankt, und nannten dies den Beta-Faktor. Der sei im Folgenden an einem praktischen Beispiel erläutert. Steigt oder sinkt der DAX um 10 %, eine einzelne der insgesamt 30 Aktien im Index gleichzeitig um 12 %, so hat diese den Beta-Faktor 1,2. Schwankt diese Aktie unter den gleichen Bedingungen nur um 8 %, so beträgt ihr Beta-Faktor 0,8. Entsprechend hat das Investment in eine Aktie mit Beta-Faktor > 1 ein größeres Verlustrisiko als die „Durchschnittsaktie“; sie liefert aber auch eine höhere potenzielle Rendite. Der Beta-Faktor ist somit ein Maß für das Rendite-Risiko-Verhältnis eines Wertpapiers oder eines ganzen Portfolios.
Die Forscher Eugene Fama und Kenneth French stellten jedoch in den 90er-Jahren fest, dass der Beta-Faktor allein nicht die Rendite von Aktien erklären kann. Es gab Aktien mit hohem Beta-Faktor, die aber keine höheren Renditen lieferten. Fama und French gewannen aus der Analyse von Aktienkursen zwischen 1963 und 1990 die Erkenntnis, dass auch die Größe eines Unternehmens (gemessen in der Marktkapitalisierung) sowie das Verhältnis von Unternehmensbuchwert und Aktienkurs zum Risiko und damit zur Renditeerwartung beitrugen.
Genauer gesagt: Fama und French stellten fest, dass kleinere Unternehmen (Small Caps) im Vergleich zu großen Gesellschaften (Blue Chips) eine höhere Rendite lieferten. Das gleiche Phänomen fanden sie bei dem Vergleich von Unternehmen, deren jeweiliger Aktienkurs gegenüber ihrem Buchwert niedrig war (Value Stocks bzw. Wertaktien), mit Wachstumsfirmen, deren jeweilige Aktien proportional zu ihrem Wert hoch notierten (sogenannte Growth Stocks bzw. Wachstumsaktien). Sie erklärten dies damit, dass Investments in kleine Unternehmen bzw. in Unternehmen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken (wie es niedrige Buchwert-Aktienkurs-Verhältnisse dokumentieren), einem höheren Risiko unterliegen und damit eine höhere Renditeerwartung haben.
Die Lehre des CAPM war, dass man das Verhältnis von Risiko und Rendite über den Beta-Faktor steuern kann. Den Beta-Faktor liefern heute die Indizes, die es für die verschiedenen Märkte gibt: Etwa der DAX für deutsche Großunternehmen, der S&P500 für US-amerikanische Gesellschaften oder der MDAX für deutsche Mittelständler. Deshalb orientieren sich heute die meisten passiven Fonds (die also, die auf die Markteffizienz-theorie vertrauen und nicht mit einem aktiven Management arbeiten) an diesen Indizes.
Die Lehre des Drei-Faktoren-Modells liefert eine erweiterte Handlungsempfehlung: Schau nicht nur auf den Beta-Faktor, sondern investiere gezielt in Small Caps und Value Stocks, um das Rendite Risiko-Verhältnis zu steuern und zu optimieren.
Kritik und Härtetest in der Finanzkrise
Kapitalmarktforschung ist keine Natur-, sondern eine Sozialwissenschaft. Deshalb können die Theorien für sich nicht den gleichen Wahrheitsanspruch geltend machen wie etwa physikalische Theorien. Besonders die Markteffizienztheorie ist sowohl von wissenschaftlicher Seite als auch von „Erfahrungsseite“ her unter Beschuss gekommen.
Die Markteffizienztheorie geht von streng rationalen, umfassend informierten Marktteilnehmern aus. Die Verhaltensökonomie hat als verhältnismäßig neue Wissenschaft jedoch herausgefunden, dass Marktteilnehmer mitnichten immer rational handeln. Herdentrieb, Gier, Angst und andere Emotionen bestimmen das Marktgeschehen in vielen Phasen ebenso stark wie dies die Vernunft tut. Das zeigt sich in den Blasen, die sich durch unvernünftige Anleger am Kapitalmarkt immer wieder bilden, um dann mit hohem Schadenspotenzial zu platzen – wie zuletzt bei der „großen“ Finanzkrise, die 2007 begann.
Stand der Diskussion heute ist, dass die Markteffizienztheorie immer noch in weiten Teilen als „gültig“ gilt. Dabei muss man sich allerdings immer bewusst sein, dass sie, wie alle Theorien, auf Vereinfachungen basiert. In normalen Zeiten sind die Vereinfachungen problemlos, in krisenhaften Situationen können sie jedoch dazu führen, dass ihre Aussagekraft zusammenbricht. – Hierzu sei am Rande bemerkt: Die Finanzkrise hat zwar gezeigt, dass Märkte nicht immer effizient sind, sie hat aber auch gezeigt, dass kaum ein Finanzmanager die Krise hat kommen sehen. Die Aussage der Markteffizienztheorie, niemand könne den Markt schlagen, ist also eher bestätigt als widerlegt worden.
Und die Finanzkrise hat zudem die Grenzen der Portfoliotheorie deutlich gemacht, als sie den Wert vieler „risikoloser“ Portfolios mit in die Tiefe gerissen hat. Die Finanzkrise war ein Ausnahmeereignis, das alle Anlageklassen betroffen hat, auch solche, von denen man geglaubt hatte, sie würden sich unabhängig voneinander bewegen. Als Folge addierten sich die Verluste, anstatt durch Gewinne oder stabile Werte kompensiert zu werden. Der Status quo zur modernen Portfoliotheorie lautet heute ähnlich wie bei der Markteffizienz-theorie: In normalen Zeiten liefert sie eine effiziente Handlungsempfehlung für Investoren. Gleichwohl kann man sich vor unvorhersehbaren Großereignissen wie etwa der letzten Finanzkrise, auch durch breit gestreute Portfolios nicht schützen. Allerdings gibt es zur Portfoliotheorie auch keine Alternativen für risikoscheue Anleger. Außerdem gilt: Wer durch die Krise hindurch in seinem Portfolio investiert blieb, der war schneller wieder auf dem Vorkrisenstand als die meisten Anleger mit einem aktiven Anlagemanagement.
Die Rollen des Finanzberaters beim wissenschaftlichen Investieren
Welche Rolle spielen Finanzberater zwischen Markteffizienztheorie, Portfoliotheorie, Beta-Faktor und Drei-Faktoren-Modell? Prinzipiell liefern die beschriebenen Theorien eine wissenschaftlich fundierte Blaupause für einen Vermögensaufbau in Eigenregie. Intime Kenntnisse über den Kapitalmarkt und seine Akteure sind nicht notwendig. Auf dem Markt gibt es genügend preiswerte passive Fonds, mit denen man sich Portfolios gemäß der eigenen Risikoneigung zusammenbauen kann.
Trotzdem ist ein seriöser Vermögensverwalter für die meisten Anleger wahrscheinlich die bessere Lösung, wenn dieser sich grundsätzlich dem wissenschaftlichen Investieren verpflichtet fühlt. Erst einmal kostet der Vermögensaufbau viel Zeit – Zeit, die nicht jeder hat, und die nicht jeder dem „schnöden Mammon“ widmen möchte.
Hinzu kommt, dass trotz der grundsätzlichen Investitionsblaupause noch viel Detailarbeit für einen erfolgreichen Vermögensaufbau zu leisten ist. Welches Portfolio passt exakt zum eigenen Risiko-Rendite-Profil? Und zwar nicht nur psychologisch, sondern auch in Hinblick auf die Lebenssituation? Welche der unendlich vielen möglichen Portfolios ist für ein gegebenes Risiko-Rendite-Profil das richtige? Wann und wie müssen die Portfolios an neue Lebensumstände oder Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt angepasst werden? Und dergleichen mehr.
Gerade für das wissenschaftliche Investieren benötigt der Anleger einen guten Partner, quasi als Coach für seine Finanzen. Dieser Finanztrainer sollte frei von Vertriebsdruck, Produktvorgaben und Interessenkonflikten agieren und immer die individuellen Bedürfnisse des Kunden im Visier haben.
Weiterführende Literatur:
Bernstein, Peter L.: Die Entstehung der modernen Finanztheorie – Von der Theorie in die Machtzentren der Weltwirtschaft, FinanzBuch Verlag 2009